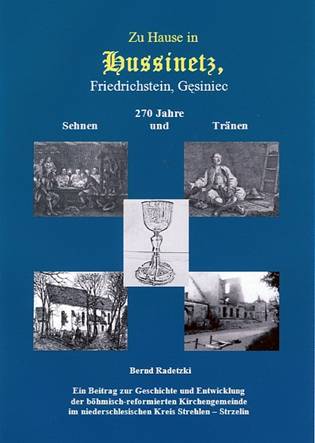Bernd Radetzki:
Zu Hause in Hussinetz
|
Für
Heimatfreunde, die sich für die Kirchengemeinde Hussinetz
interessieren, wird diese Nachricht ein besonderer „Leckerbissen“ sein. So
wird in diesem Monat (Februar 2012) das von Herrn Bernd Radetzki
geschriebene Buch „Zu Hause in Hussinetz, Friedrichstein,Gesiniec“ beim Preußler Verlag in Nürnberg erhältlich sein. Es umfasst
500 Seiten und kostet 28,-EUR. Interessenten können sich an Herrn Radetzki wenden: Bernd Radetzki Mittelshuchtinger Dorfstr, 28259 Bremen Tel.: 0421/ 581102 E-Mail: bernd.radetzki@gmx.de |
|
Zusammenfassung des Inhalts
Um
die Jahreswende 1741/42, während des 1. Schlesischen Krieges, kamen etwa 2000 Migranten aus den grenznahen ländlichen Gebieten Böhmens
nach Schlesien, wo ihnen Friedrich der Große Schutz gewährte. Grund war die
konfessionelle Unterdrückung, denn sie fühlten sich in der Tradition der
Böhmischen Brüder, nannten sich anfangs auch gern Hussiten und lehnten den im
Habsburger Machtbereich staatlich verordneten katholischen Glauben ab. Außerdem
sehnten sie sich danach, als freie Bauern auf eigenem Grund und Boden leben zu
können.
Nach
einigen Jahren der Entbehrung in Münsterberg (heute: Ziębice)
konnten 147 Familien mit Hilfe ihres Pfarrers Blanitzky
vor den Toren der niederschlesischen Stadt Strehlen (heute: Strzelin)
Land kaufen und ab 1749 einen ganz neues Dorf erbauen, das sie nach dem
Reformator Jan Hus Husinec
nannten, deutsch: Hussinetz. Hier fanden sie endlich
eine neue Heimat, Freiheit im Glauben
und Unabhängigkeit von feudalistischer Herrschaft.
Dieses
neue Zuhause umfasste dann 200 Jahre lang für die Neusiedler und ihre
Nachkommen nicht nur Haus, Hof, Garten und Felder. Es bezog sich auch auf die
neu entstandenen familiären Bindungen und die Nachbarn. Man blieb weitgehend
unter sich und bewahrte die Bräuche und die böhmische Sprache. Die böhmischen
Lieder und die in der Kirche verwendeten Bücher halfen ihnen bei der Pflege der
Tradition. Besonders genau achteten sie auf die Einhaltung der Privilegien, die
ihnen Friedrich der Große eingeräumt hatte. So behielten die Kolonisten, soweit
es möglich war, ihre Unabhängigkeit von der staatlichen und kirchlichen
preußischen Obrigkeit. Geführt und unterstützt wurden sie dabei von ihren
Predigern und Pastoren.
Diese
Geschichte wird in einem weit geschlagenen Bogen beschrieben und mit vielen
Dokumenten belegt. Wo es möglich gewesen ist, sind Namen und Herkunft der
Menschen erfasst worden. Die alten Ansiedlungsurkunden und frühen Kaufbriefe
aus der Zeit Friedrichs des Großen, der Aufbau und die Organisation des neuen
Gemeinwesens und weitere Ortsgründungen in der Nähe
bilden einen besonderen Schwerpunkt. Das Geschehen im Pfarrbezirk wird mit
vielen Details dokumentiert. Dabei wird auch über die böhmische Kirche mit
ihren Friedhöfen, die Lebensläufe aller Pastoren der Parochie
und alle gefeierten Ortsjubiläen ausführlich berichtet. Der Leser erhält einen
breiten Einblick in 200 Jahre Ortsgeschichte.
Dann
folgt ein Bericht zur Evakuierung im Winter 1944/45. Bald nach Kriegsende
flossen 1945 Tränen des Abschieds. Etwa 1000 Personen böhmischer Herkunft reemigrierten in
die Tschechoslowakei. Andere mussten ihre Heimat in Richtung Mittel- und
Westdeutschland verlassen. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
wurde das Ende der böhmischen Geschichte in den Gemeinden um Strehlen
besiegelt. Zunächst gab es noch eine tschechische Schule und Laienprediger, die
den Gottesdienst aufrecht erhielten, später dann Pastoren der reformierten
Kirche Polens. Die böhmischen Wurzeln sind heute nur noch in wenigen Familien
zu finden. Geblieben sind die zerstörten Friedhöfe mit wenigen restlichen
Grabsteinen sowie die alte böhmisch-reformierte
Kirche, die 1982 an die polnische Gemeinde übergeben wurde und nach Restaurierung
und Renovierung nun als katholisches Gotteshaus dient. Die schlechten Zeiten
überdauert hat auch das Hussinetzer Denkmal zur
Erinnerung an die Toten des 1. Weltkrieges. Es wurde etwa 1965 umgestürzt und
im Jahr 2005 von der Stadt Strehlen neu aufgerichtet. Über das Geschehen in der
Nachkriegszeit wird ebenfalls bis zum Jahr 2011 berichtet, veranschaulicht
durch viele Fotos von Menschen, Landwirtschaften, Gebäuden mit
Lüftungsöffnungen in Kelchform und den noch erkennbaren Gräbern.